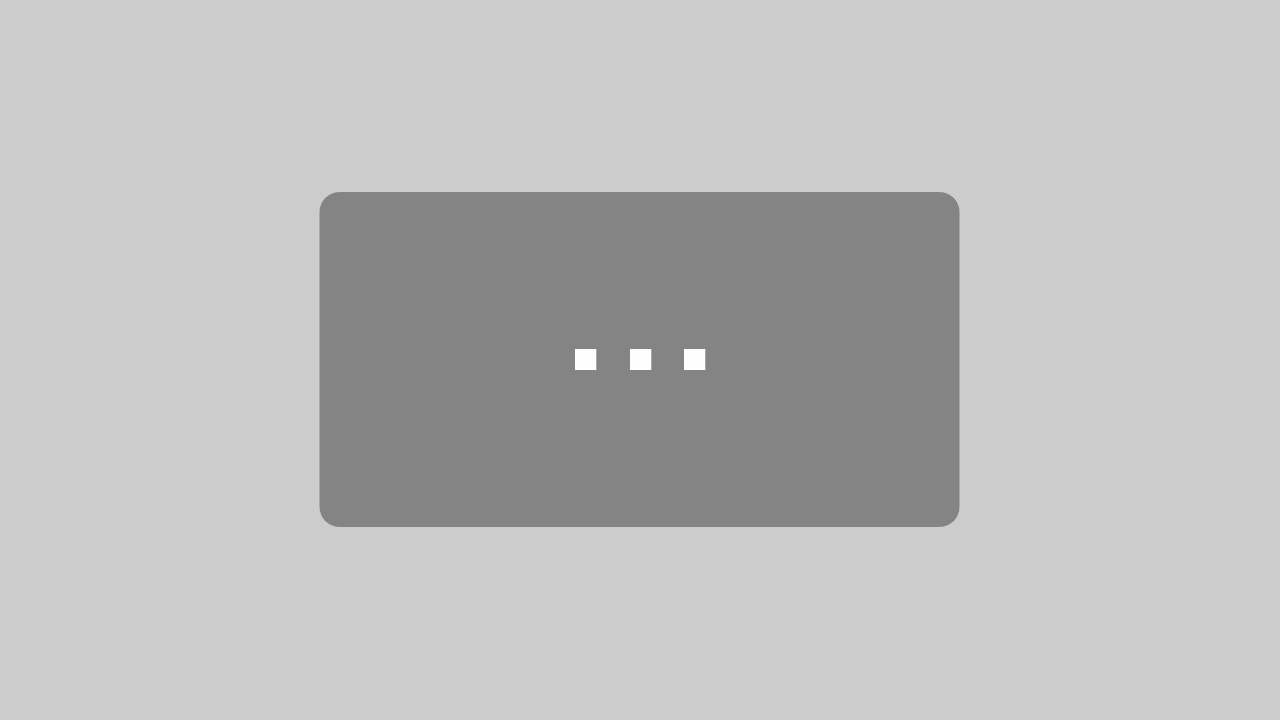Teil zwei des Smarter Service Talks mit Prof. Dr. Alexander Mädche, Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
Herr Professor Mädche, können Sie uns an dieser Stelle durch Ihr Framework führen und erklären, welche Instrumente aus Ihrer Sicht auf der Reise der Produktentwicklung zum Einsatz kommen und wie sie wirken?
Zunächst ist es wichtig, Strategie und Vision klar zu artikulieren. Es braucht dann ein Geschäftsmodell. Das „Business Model Canvas“ ist eine Möglichkeit zu beschreiben, wie die Strategie die einzelnen Akteure auf einer hohen Abstraktionsebene beeinflusst. Die nächste Ebene sind die Roadmaps für das Produkt oder den Dienst. Auch hier gibt es Roadmapping-Techniken, mit deren Hilfe sich beschreiben lässt, wie der Artefakt weiterentwickelt werden soll.
Hat man dann einen Funktionsbaustein definiert, werden klassische agile und schlanke Entwicklungsmethoden angewandt, mit deren Hilfe der Scope definiert werden kann. Und auch für das Scoping gibt es Methoden.
Im Entwicklungsprozess selbst werden die unterschiedlichen Design-Techniken mit den Entwicklungstechniken verzahnt, die aus der agilen Umgebung kommen. So kommt das Unternehmen zu einer Lösung, die es auch inkrementell weiter verändern kann. Man sollte nicht davon ausgehen, dass der erste Schuss der letzte ist, sondern über die Nutzung gilt es zu lernen. Ich spreche also nicht von einer Methode, sondern von einer großen Anzahl von Techniken, die zur Anwendung kommen. Weil sie aus unterschiedlichen Backgrounds kommen, ist es relativ schwierig, sie zu integrieren, aber sie müssen verzahnt werden.
Bedeutet das für Unternehmen nicht einen „Clash of Culture“? Insbesondere für Firmen, die originär keine Technologieunternehmen sind?
Auch große Unternehmen wie SAP sind sehr gefordert, sich zu transformieren. Agile Softwareentwicklung wurde dort mittlerweile gut umgesetzt. Gleichzeitig hat SAP das Thema User-Experience auf dem Radar. Strukturen und Kulturen verändern sich massiv. Früher war die Entwicklungsabteilung sauber getrennt vom Marketing und vom Produktmanagement, auch Usability und User-Experience waren eigene Bereiche. Heute wird das alles viel stärker verschmolzen, und es ist tatsächlich fundamental, in Teams zu agieren, die diese Skills zusammenbringen.
Microsoft ist ein weiteres Beispiel. Nach dem Clash mit Windows Vista hat das Unternehmen seine gesamte Organisation auf agil umgestellt. Es dauerte drei Jahre, die agilen Prozesse nicht nur zu installieren, sondern auch zu leben. Agilität lässt sich einem Team nicht in Form eines Prozesses vorschreiben, sondern muss in einem täglich praktiziert werden, indem sie Teil des Denkens, der Kultur und der Zusammenarbeit wird. Dieses Thema braucht Zeit und eine hohe Aufmerksamkeit des Managements, es muss wertgeschätzt und in der Organisation vorangetrieben werden.
Bei den klassischen Industrieunternehmen passiert etwas sehr Ähnliches. Ich habe von einem großen Maschinenbauer erfahren, der jetzt auch agile Methoden für die Entwicklung von Maschinen anwendet. Bisher wurden komplexe Maschinen in einem klassischen Ingenieurs-Ansatz entwickelt – mit der Gefahr, ein wenig am Kunden vorbei zu entwickeln. In den neuen agilen Konzepten geht es stark um Kommunikation und die Fähigkeit, Änderungswünsche mit aufzugreifen. Auch Unternehmen wie Bosch investieren massiv in dieses Mindset. Mir ist ganz wichtig, dass dies nicht als reines Prozess-Thema angesehen wird, sondern als ein Thema der Kulturveränderung in der Organisation.
Ein Vordenker in der Organisation, Niels Pfläging, sagt, man muss das System irritieren, wenn man es verändern will. Dazu müssen die Menschen in einen anderen Kontext versetzt werden. Und nur fünf Prozent der Menschen sind veränderungsunwillig, während die meisten dem offen gegenüberstehen. Diese Meinung wird aber in der Branche der Softwareentwicklung nicht unbedingt geteilt. Was ist Ihre Erfahrung? Kann ein Unternehmen mit allen Beschäftigten in die neue Welt gehen? Oder sollte es mit einigen wenigen starten und den Kreis sukzessive erweitern, um in die Transformation zu kommen?
Es ist ein bekanntes Muster im Change-Management, dass man Erfolge braucht. Ich rate dazu, in einer gut definierten Umgebung mit ausgewählten Menschen einen Showcase zu fahren, der sich positiv auf die Allgemeinheit auswirkt. Agilität und Design-Orientierung lassen sich aber wie gesagt nicht verordnen. Wie bei allen Veränderungen gibt es natürlich auch immer Resistenz. Arbeitgeber sollten auf das Individuum eingehen, um zu verstehen, was den Menschen beschäftigt. Ich denke nicht, dass es ein Standard-Vorgehen gibt. Zu berücksichtigen ist immer auch, von wo die Organisation kommt, welches ihr Background ist und welches Mindset die Beschäftigten haben. Ähnlich wie andere Change-Aktivitäten in der Organisation braucht es sehr viel Aufmerksamkeit.
Technologie ist die Anatomie von Smart Service, vergleichbar mit dem Teil eines Eisbergs, der unter dem Meeresspiegel verbaut und nicht sichtbar ist – in der Cloud sozusagen. Durch neue Geschäftsmodelle verändert sich nun die Art und Weise, wie ein Unternehmen sein Betriebsmodell organisiert. Wie sollten Daten gesammelt, integriert und verfügbar gemacht werden, damit das Unternehmen daraus Erkenntnisse ziehen kann? Und wie macht es das Ganze sicher?
Dafür braucht es Spezialkompetenzen. Wir haben in Karlsruhe die deutschlandweit größte Fakultät für Informatik. Hier sitzen Experten, die zum Beispiel Fragen der Kryptografie im Kontext der Sicherheit lösen und neue Methoden erforschen. Mir liegt es am Herzen, diese Forschung mit den praktischen Herausforderungen der Unternehmen zusammen zu bringen. Für den Wissenstransfer haben wir am KIT verschiedene Formate entwickelt. Ein Beispiel ist das „Smart Data Innovation Lab“. In dieser von der Bundesregierung geförderten Initiative halten wir Software-Infrastrukturen von IBM, SAP oder der Software AG vor und entwickeln mit echten Daten aus Unternehmen Prototypen.
Wir zeigen: Was ist das Potenzial, was sind die technischen Herausforderungen, funktioniert das überhaupt, und lohnt es sich, in das Thema zu investieren? Hier werden die technischen Herausforderungen mit der betriebswirtschaftlichen Perspektive verzahnt. Ein anderes Format ist „Industry-on-Campus“: Hier arbeiten wir im Rahmen des Karlsruhe Service Research Institutes (KSRI) sehr eng mit Unternehmen wie IBM und Bosch zusammen. Diese Firmen entsenden auch Mitarbeiter, welche dann vor Ort am KIT sitzen und arbeiten. Zusätzlich ist uns am KIT sehr wichtig gesellschaftliche Themen wie Ethik und Jura mit der Technik und den ökonomischen Fragen zu kombinieren.
Kommen wir abschließend nochmal zur Challenge, von der Sie sprachen. Dass man Studenten an praktischen Aufgabenstellungen hat arbeiten lassen, gab es immer schon. Bei Ihnen geht es aber von der Produktidee bis zur Platform-as-a-Service und einem funktionsfähigen Prototypen. Kommt am Ende eine Innovation zum Tragen, die die Unternehmen als Service auf der gleichen Plattform für alle verfügbar machen könnten?
Nein, so weit gehen wir nicht. Wir entwickeln an der Uni keine Produkte. Wenn ein Unternehmen unseren Prototypen klasse findet, kann es ihn gerne weiter produktisieren. Wenn Studenten daraus ein Start-up machen wollen, freut uns das auch, denn wir wollen die Start-up-Szene in Karlsruhe fördern. Wir machen ein wenig Match-Making, weil es wichtig ist, dass sich junge Menschen etwas zutrauen. Früher war es viel aufwendiger, eine lauffähige Software zu produzieren. Das wäre inklusive Geschäftsmodell, Prototyping und Konzept in nur einem Semester unmöglich gewesen. Aber aufgrund der Reife der verfügbaren Technologien und aufgrund der verfügbaren Methoden und Techniken lässt sich heute vergleichsweise schnell etwas produzieren. Wir machen den Studierenden Mut, Dinge auszuprobieren und nicht Ewigkeiten darüber nachzudenken. Feedback ist sehr lehrreich. Im Beispiel von unserer Mobile Payment Challenge haben die Studierenden Schüler gefragt, zu welchen Bedingungen sie Mobile Payment einsetzen würden. Wir lernen unheimlich viel, wenn wir in den Dialog gehen.
Aus der Bewegung des Maker-Movement stammt der Slogan „Make Things Not Slights“. Beim Bauen smarter Produkte haben wir das Software-Problem und das Thema Cloud gelöst, auch sind wir in der Lage, prototypenhaft Produkte zu produzieren. Jetzt das Aber: Technisch einwandfreie und skalierbare Produkte wie etwa ein Smartphone zu produzieren, ist „Black Magic“, so hat es ein Redner einmal in seinem Vortrag formuliert. Sehen Sie besondere Chancen für den deutschen Mittelstand, der in diesem Kontext am wenigsten angreifbar ist, weil er weiß, wie man Dinge herstellt?
Ja. Wir haben alle Skills, die wir brauchen. Ich denke aber, dass wir diesen Mix aus End-to-End und Experimentierfreudigkeit geschickter kombinieren müssen. Nicht alle können ein Mobiltelefon herstellen, aber vielleicht eine Smartphone-App. Deutsche Maschinenbauer bieten tolle Produkte an, und wenn sie experimentierfreudig sind, erweitern sie diese Produkte durch wertschöpfende Smarte Dienste. Das kann dann ein ganz fundamentaler Impact für das Geschäftsmodell, die Kundenbindung und die Customer Experience sein. Diesen Mix brauchen wir.